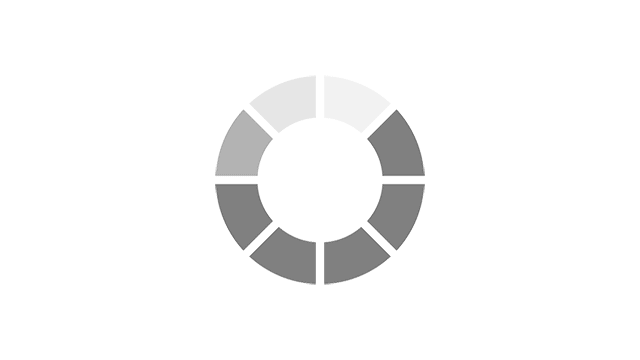
Die Organtransplantation in Deutschland ist seit vielen Jahren durch zu wenige Organspender und lange Wartezeiten auf ein Spenderorgan eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund ist in den kommenden Jahren eine Reihe von Änderungen zu erwarten, die in erster Linie darauf abzielen, den Kreis potenzieller Spender zu erweitern.
Ende 2024 waren 8.575 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan, 8.575 Organe wurden benötigt. Dem gegenüber stehen 953 verstorbene (postmortale) Organspender mit 2.855 gespendeten Organen – etwas mehr als im Jahr zuvor. Manche Patienten auf der Warteliste müssen aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands wieder von der Warteliste genommen werden, andere wiederum versterben während der Wartezeit, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan erhalten.1,2 Hier finden Sie Erläuterungen zur Warteliste und Vermittlung von Organspenden in Deutschland.

Benötigte Organe, gespendete Organe und transplantierte Organe 2024 in Deutschland im Vergleich
Insgesamt wurden 2024 in Deutschland 3.013 Organe nach postmortaler Spende transplantiert (siehe Abbildung oben). Diese Zahl liegt höher als die der hierzulande gespendeten Organe, denn sie umfasst auch Organe, die über die Vermittlungsstelle Eurotransplant aus deren Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt wurden. Demzufolge gilt Deutschland als „Importland“: 2024 wurden 538 Organe nach Deutschland importiert, aber nur 377 exportiert. Auch im internationalen Vergleich mit weiteren europäischen Staaten steht Deutschland weit hinten. Die jährliche Anzahl postmortaler Spender pro Million Einwohner lagen hier in den letzten Jahren um die 10. In Spanien, dem Land mit den höchsten Spenderzahlen, wurden Zahlen von über 40 erreicht.1

Anzahl postmortaler Organspender pro Million Einwohner in den Ländern mit den europaweit höchsten und niedrigsten Zahlen, sowie Deutschland (2024)
Trotz kleiner Fortschritte in den letzten Jahren weisen diese Statistiken der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) darauf hin, dass hierzulande auch weiterhin Bedarf für eine Verbesserung der Organspende-Situation besteht.
Weitere Daten zur Organspende-Situation finden Sie auf den Seiten der DSO.
Die aktuelle Rechtslage für Organspenden in Deutschland sind durch das Transplantationsgesetz (TPG) geregelt. Zudem gibt es von der Bundesärztekammer detaillierte Richtlinien zur Organvermittlung. Die Vergabe von Spenderorganen erfolgt nach strengen Kriterien. Hierbei stehen die Erfolgsaussicht der Transplantation und die Dringlichkeit sowie die Chancengleichheit im Vordergrund.
Bislang gilt in Deutschland für die postmortale Organspende die sog. Entscheidungslösung. Demnach muss jeder Mensch zu Lebzeiten einer Organ- oder Gewebespende ausdrücklich zustimmen, etwa in einem Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung. Liegt keine schriftliche Erklärung vor, können die Angehörigen im Sinne der betreffenden Person zustimmen.
Ausführlichere Informationen über medizinische, gesetzliche und organisatorische Voraussetzungen sowie den Ablauf einer Organspende und -transplantation finden Sie hier auf „Leben mit Transplantation“ sowie auf den Seiten der DSO und der Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit (BIÖG).
Aufgrund des andauenden Mangels an Spenderorganen fordern Experten schon seit Jahren Reformen beim TPG ein. „Nach 25 Jahren ist das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß“, sagte Prof. Barbara Suwelack, ehemalige leitende Oberärztin der Transplantationsnephrologie am Universitätsklinikum Münster und Mitglied im Vorstand der Deutschen Transplantationsgesellschaft in einem Interview. In der Vergangenheit gab es bereits einige Bemühungen zur Reform des TPG, die jedoch aufgrund fehlender Mehrheit scheiterten. Nun zeichnet sich ab, dass es in naher Zukunft tatsächlich zu Gesetzesänderungen kommen könnte, um die Zahl der Organspender zu erhöhen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Umstellung auf eine Widerspruchsregelung. Hierbei gilt grundsätzlich jeder einwilligungsfähige Erwachsene nach seinem Hirntod als Organspender, sofern er dem zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Der Widerspruch kann auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht bzw. dokumentiert werden: im Organspende-Register, im Organspendeausweis, in einer Patientenverfügung, in der elektronischen Patientenakte, auf einem Zettel oder in einer Notfall-App auf dem Smartphone.

Anfang Juli 2024 hat der Bundesrat einen Gesetzentwurf für die Einführung einer Widerspruchsregelung vorgelegt.3 Kurz zuvor gab es bereits eine neue Initiative einiger Bundestagsabgeordneter.4 Im nächsten Schritt muss der Bundestag über den Gesetzentwurf abstimmen. Sollte sich eine Mehrheit für die Änderung entscheiden, wird das BIÖG alle erwachsenen Einwohner anschreiben und über die geänderte Rechtslage informieren.
Für Ärzte und andere Mitarbeiter in der Transplantationsmedizin würde die Umstellung auf die Widerspruchregelung eine Erleichterung bedeuten. Laut Prof. Suwelack gäbe es im Idealfall dadurch einen klareren Überblick über die Entscheidungen von potenziellen Spendern.
Hier geht es zum gesamten Interview mit Prof. Suwelack.
Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Organspende-Situation wurden in den letzten Jahren entweder bereits umgesetzt oder sollen in nächster Zeit weiterentwickelt werden.
Dazu zählt die Einführung eines elektronischen zentralen Organspende-Registers, auch bezeichnet als Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende, durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Es wird seit März 2024 in mehreren Stufen aufgebaut. Neben dem Organspendeausweis und der Patientenverfügung bietet es eine weitere Möglichkeit, die Bereitschaft zur Organspende rechtlich verbindlich und zuverlässig auffindbar zu melden und zu dokumentieren. Die Registrierung ist kostenlos und freiwillig und kann jederzeit geändert oder widerrufen werden.
Mehr Informationen zum Organspende-Register finden Sie auf den Seiten des BfArM.

Eine andere Form, die Spendenbereitschaft zu signalisieren, ist das auch als Opt.Ink bezeichnete Organspende Tattoo. Es geht aus einer Initiative des gemeinnützigen Vereins Junge Helden hervor. Das geometrische Design zeigt einen Halbkreis, zu dem eine andere Hälfte dazu kommt, um ein Ganzes zu werden. Es symbolisiert das Geschenk des Lebens – die Organspende. Mehr dazu erfahren Sie auf den Seiten des Vereins Junge Helden.
Das Organspende Tattoo alleine ohne schriftliche Zustimmung ist allerdings keine rechtsgültige Form der Dokumentation. Es kann jedoch als Willensbekundung gewertet werden und Angehörigen bei der Entscheidungsfindung helfen, wenn keine weitere schriftlich dokumentierte Entscheidung vorliegt.
Zur Bekanntheit des Tattoos hat eine gemeinsame Aktion einiger Bundestagsabgeordneter im Mai 2024 beigetragen. Parlamentarier verschiedener Parteien ließen sich ein solches Organspende Tattoo stechen, um ihrerseits ein Zeichen für Organspende zu setzen.5

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner MdB unterstützt die Jungen Helden und die „Opt-Ink“-Initiative schon seit vielen Jahren
Vor dem Hintergrund des Spenderorganmangels hat die Lebendspende einer Niere oder eines Teils der Leber einen hohen Stellenwert in der Transplantationsmedizin. In Deutschland lag deren Anteil an allen Nierentransplantationen in den letzten Jahren zwischen 24% und 29%. Bei der Leber-Lebendspende waren es 2023 rund 6%.1,6 Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema Lebendspende.
Rechtlich ist eine Organentnahme bei lebenden Spendern nur zulässig, wenn kein geeignetes Organ eines postmortalen Spenders zur Verfügung steht.7 Fachleute wie Prof. Suwelack fordern schon seit längerer Zeit, dieses so genannte Subsidiaritätsprinzip oder Nachrangigkeitsprinzip abzuschaffen, um mehr Lebendspende-Transplantationen zu ermöglichen.
Voraussetzungen, die beim Spender erfüllt sein müssen, umfassen die Freiwilligkeit sowie eine enge persönliche Verbundenheit zum Empfänger. Dies gilt in der Regel für enge Verwandte, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Verlobte oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen.7
Aber auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann es sein, dass potenzieller Spender und Empfänger aufgrund immunologischer Merkmale (z.B. Blutgruppe) nicht zueinander passen. Dann wird die Lebendspende aus medizinischen Gründen abgelehnt, weil das Risiko einer Abstoßung des gespendeten Organs zu groß ist. Hier könnte in manchen Fällen eine sog. Über-Kreuz-Lebendspende (Cross-over-Lebendspende) eine Lösung bieten. Dabei wird eine Niere von einem Spender-Empfänger-Paar an ein geeignetes anderes Paar übertragen, so dass zwei Lebendorganspenden kreuzweise durchgeführt werden können.

Über-Kreuz-Lebendspende (Cross-over-Lebendspende)
Um die Lebendorganspende künftig zu erleichtern, hat das Bundeskabinett im Juli 2024 den Entwurf für eine Änderung des Transplantationsgesetzes beschlossen. Der Gesetzentwurf hat u.a. zum Ziel, die Über-Kreuz-Lebendspende einer Niere in Zukunft auch zwischen zwei Spender-Empfänger-Paaren zu ermöglichen, die sich nicht zwangsläufig nahestehen müssen. Auch eine nicht gerichtete anonyme Nierenspende soll ermöglicht werden. Im Zuge dieser Änderungen ist auch eine Neuregelung der Vermittlung und Durchführung der Über-Kreuz-Nierenspende vorgesehen.8
Im Rahmen der geplanten Neuerungen soll zudem das bislang geltende Nachrangigkeitsprinzip aufgehoben werden. Dies bedeutet, dass eine Lebendspende-Nierentransplantationen künftig durchgeführt werden kann, unabhängig davon, ob ein postmortal gespendetes Organ verfügbar ist.8
Darüber hinaus soll der Schutz des Lebendspenders künftig weiter gestärkt werden.8
Näheres zur Lebendorganspende-Reform können Sie in einem Artikel des Deutschen Ärzteblatts oder direkt in einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit nachlesen.
Mit dem 2020 eingeführten Lebendspende-Register wurde darüber hinaus der Grundstein für eine bessere Versorgung der Lebendspender von Niere (SOLKID-GNR = Safety of the Living Kidney Donor – The German National Register) oder Leber (SOLiD-GNR = Safety of the Living Donor – The German National Register) gelegt. Es hat zum Ziel, durch systematische Erfassung von Daten zur Nieren- und Leber-Lebendspende vor und nach Organentnahme die Einschätzung der medizinischen und psychosozialen Risiken und damit die Nachsorge für Lebendspender im deutschen Gesundheitssystem im Langzeitverlauf zu verbessern.
Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website des Lebendspende-Registers.
MAT-DE-NON-2025-00413 | Erstellt: Dezember 2025